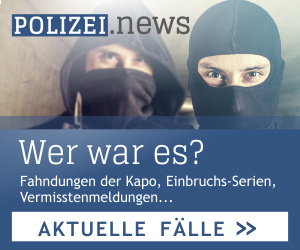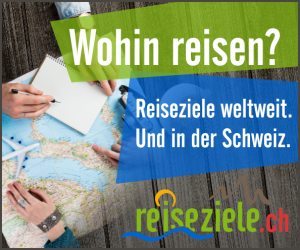Ex-Raiffeisen-Chef hält Put-Optionen auf Raiffeisen-Tochter
belmedia redaktion Finanzen News
Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hat Put-Optionen auf die Raiffeisen-Tochter Investnet, die es ihm erlauben, seinen 15-Prozent-Anteil am KMU-Finanzierer in zweieinhalb Jahren wieder an die Genossenschaftsbank zu verkaufen. Dies schreibt die „Handelszeitung“ in ihrer neusten Ausgabe. Der künftige Verkaufspreis der Investnet-Anteile bemisst sich an einer Bewertungsmethodik, die festgelegt wurde, als Vincenz noch als Raiffeisen-Chef amtete. Der Sachverhalt stellt einen weiteren möglichen Interessenkonflikt in Vincenz' Investnet-Investment dar, das die Finma derzeit im Rahmen eines Enforcement-Verfahrens gegen den Ex-Chef und die Raiffeisen untersucht. Aus dem Umfeld des Bündner Bankers ist zu hören, dass Vincenz an dieser „Formel“ nicht „aktiv und direkt“ mitgewirkt habe. Vielmehr soll die Bewertungsfrage zwischen Finanzexperten der Raiffeisen Bank und den beiden Investnet-Gründern geklärt worden sein.
Weiterlesen