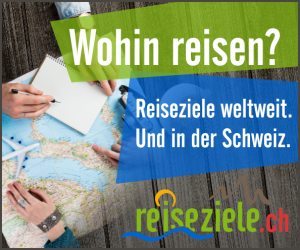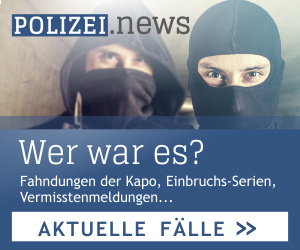Politische Krise zwingt russische Wirtschaft in die Knie
VON David Weiss News
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Es ist noch nicht sicher, ob sich die Machtprobe mit dem Westen im Ukraine-Konflikt für Russland politisch auszahlen wird. Wirtschaftlich rutscht das Riesenreich in eine tiefe Krise – und diese könnte noch verschlimmert werden, sollte die EU tatsächlich weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen das Land verhängen. Die russische Zentralbank musste deshalb jüngst sogar einen Schritt gehen, der gegen die Massnahmen gerichtet ist, welche der Rest der Erde in diesen Monaten für angemessen hält. Russland hat mit einer starken Inflation zu kämpfen. Durch die geopolitischen Spannungen haben die Investoren das Vertrauen in das Land und seine Währung verloren. Güter aus dem Ausland werden immer teurer, wodurch die Preise explodieren. Die Zentralbank schraubte den Leitzins deshalb um 50 Basispunkte auf 8 % in die Höhe. In den letzten fünf Monaten hatte es bereits zwei weitere, zum Teil deutliche Erhöhungen gegeben. Als Vergleich: Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Leitzins für den Euroraum wegen der anhaltenden Deflationsgefahr in Südeuropa vor Kurzem auf 0,15 % nach unten gedrückt. Russland und Europa trennen im Moment nicht nur politische Einstellungen.
Weiterlesen